Der Bär und die Nachtigall
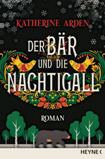

Im Vergleich zur griechischen Mythologie oder nordischen Mythologie ist die slawische Mythologie in westlicher Literatur wenig verarbeitet. Das liegt auch daran, dass die slawischen Völker zwar von Russland über Polen bis Nordmazedonien reichen, es aber kaum eine einheitliche Mythologie gibt. Prominent sind viele lokale Ausprägungen: Elementargeister, Hausgeister und (seltener) vorchristliche Götter. Bekannt ist im Westen vor allen anderen die Hexe Baba Yaga mit ihrem fliegenden Mörser und dem Haus auf Hühnerbeinen.
Bei slawischer Mythologie denken viele direkt an Russland. Das ist jedoch verkürzt, denn die slavischen Völker umfassen Westslaven (Tschechen, Slovaken, Polen, Sorben), Ostslaven (Russen, Belarussen, Ukrainer) und Südslaven (Balkan).
Gerechtfertigt ist dies im Umfeld des Mythos wiederum, da keine zusammenhängende, übergreifende Mythologie existiert. Selbst archäologische Funde sind verstreut und fragmentiert. Insgesamt scheint die slavische Mythologie jedoch nicht von einem Götterpantheon dominiert, sondern vielmehr von einigen ähnlichen Vorstellungen mit starken örtlichen Gebräuchen.
Die ursprünglichen Bräuche und Vorstellungen, sofern sie überhaupt niedergeschrieben wurden, sind zudem stark durchs spätere Christentum beeinflusst worden und oft verfälscht.
Die Forschung nimmt heute (nicht ohne Gegenmeinungen) an, dass die Slawen erst unter äußeren Einflüssen ein Pantheon entwarfen; andere nehmen an, dass es existierte, aber unterschiedliche Regionen unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Weitereichend Einigkeit herrscht in der Annahme, dass es ein solches Pantheon in früheren Zeiten gegeben hat. Dies wird unter anderem aus dem Wort bog für Gott geschlossen, das sich in allen slawischen Sprachen findet.
Jene Götter sind geprägt von den Ursprüngen als Steppennomaden in einem weiten Land. Gelegentlich unter anderen Namen findet man 4 Hauptgötter:
Die einzelnen Slawen hatten zudem unterschiedliche weitere Götter wie Stribog, Chors, Simargl und Mokosch bei den Ostslaven; und Svarozic, Svantovit und Triglaw bei einzelnen Stämmen von der Ostsee bis zur Elbe.
Es gibt viele Listen weiterer slawischer Gottheiten. Aber viele dieser Namen sind falsch: Manchmal wird eine Verbindung hinzugedichtet; ein andermal eine nur zufällige Verbindung oder ein Aspekt jenseits jeglicher Proportion überbetont; ein weiteres Mal wird volksetymologisch frei erfunden.

Einer der bekanntesten Naturgeister ist Djed Moros, meist unter dem Namen Väterchen Frost und ursprünglich ein Winddämon des kalten Winterwetters. Auch die Baba Yaga war ein solches Luftwesen und wird heute sehr ambivalent dargestellt: Einerseits hilft sie frei, andererseits frisst sie Menschenfleisch und hat nichts Gutes im Sinn. Von den Erdgeistern zeugen vor allen Erzählungen von Riesen wie Rübezahl oder Zwerge. Zu den Wassergeistern gehören die Rusalkas, die dem Volksglauben nach aus Mädchen entstanden, die einen unreinen Tod erlitten, und Männer mit sinnlichen Versprechen in den Tod locken. Sie werden meist ähnlich wie Nymphen dargestellt. Die Wassermänner, Vodyanoy, trifft man öfter auch reptilartig. Unter den Feuergeistern nahm das Herdfeuer besondere Beachtung ein sowie viele kleine fliegende Wesen.
Neben den Elementarwesen reicht der Kult um Hausgeister wie der Domovoj (Beschützer von Haus und Stall) und seinem Gegenbart der Kikimora oder dem Bannik (Geist des Bades) bis in die heutige Zeit. Diese Hausgeister galten als die Beschützer des Gebäudes, waren manchmal Vorfahren oder ein Elementargeist.
Im Gegensatz zu vielen anderen Kulturen war der Totenkult eher gering ausgeprägt: Die Seele des Toten verließ den Körper und das Haus, blieb dann dauerhaft an einem Ort oder ging in ein nicht weiter beschriebenes Jenseits.
Besonders hervorgetan bei der Illustration russischer Märchen hat sich Ivan Jakovlevic Bilibin (1876-1942):

Bannik

Kikimora

Vodyanoy
Für die Sammlung insbesondere russischer Volksmärchen ist vor allem Alexander Nikolajewitsch Afanasev zu danken, der für diese Märchen eine ähnliche Rolle spielte wie die Brüder Grimm hierzulande. Im Gegensatz zu den Grimms sammelte Afanasev mehr und bearbeitete kaum. Je nach Zählweise kommt man daher auf 200 bis 600 unterschiedliche Märchen mit zahlreichen Varianten.
Dies ist für russische und slawische Märchen heute charakteristisch: Das Märchen von einer bestimmten Figur gibt es nicht: Je nach Erzähler unterscheiden sich die Details. Gleichzeitig ist eine Vielzahl stets wiederkehrender Figuren in verschiedenen Märchen typisch: Baba Yaga, Koschtschei, der Feuervogel ... (s. u.) tauchen in vielen der Tier- und Zaubermärchen auf.
Slavische Fantasy (manchmal auch verengend Russische Fantasy) formte sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ist als eigenständige Gattung aber eher selten vermarktet. Wie dem Namen nach zu erwarten baut slavische Fantasy auf den Legenden und Mythen des slavischen Volksglaubens auf und ist daher eine Untergattung der Mythic Fantasy. Im Weiteren lassen sich diese Werke durchaus den anderen Klassifikationen von Fantasy zuordnen, von episch über romantisch und humoristisch bis hin zu heroisch und Science Fantasy. Am vielleicht bekanntesten unter den modernen Formen ist Andrzej Sapkowskis Hexer-Reihe mit mehreren eigenen Computerspielen, die viele Figuren und Orte aus der slavischen Geschichte und Mythologie entlehnt.
Einen ersten Beginn slawischer Fantasy kann man jedoch so früh wie 1833 finden mit Alexander Fomich Veltmans Roman Koshchei bessmertny: Bylina starogo vremeni (Koschtschei der Unsterbliche: eine Bylina der alten Zeiten), eine Parodie auf gängige Abenteuerromane mit einer Art russischem Don Quijote.
In Deutschland ist die slawische Mythologie oft unbekannt und ein erster Kontakt geschieht entweder durch Sammlungen von Märchen (oft russischer Märchen) oder durch die Verarbeitung typischer Figuren. Hierbei unterscheidet sich die individuelle Darstellung der Wesen je nach Autor, hat jedoch eine gemeinsame Basis. Insbesondere bei Märchen lassen sich sowohl im Kern gleiche Erzählungen mit doch einigen Eigenheiten erkennen. Alle Namen existieren durch die Transkription und Verbreitung in verschiedenen Schreibweisen.


Dieses Schlagwort wurde veröffentlicht am und zuletzt geändert am .